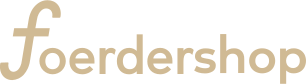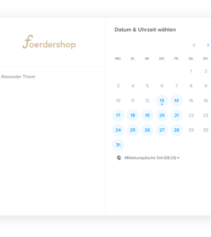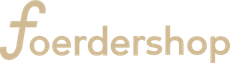Fördermittelberater werden [in 2025]
1. Überblick zum Thema Fördermittelberater werden
Überspitzt gesagt, kann sich jeder in Deutschland als Fördermittelberater bezeichnen, da dies keine geschützte Berufsbezeichnung ist.
Sie benötigen also theoretisch kein bzw. keinen Kurs, Zertifikat, Weiterbildung, Fortbildung oder Seminar zum Fördermittelberater, um sich genauso zu bezeichnen. Genau wie beim Unternehmensberater.
Zwischen Fördermittelberatern gibt es jedoch meilenweite Unterschiede, nicht nur in der Qualität der Arbeit, sondern auch in Bezug auf Tätigkeitsfelder bzw. Förderprogramme, Kundenzielgruppen, Vergütungsmodelle und Honorare. Natürlich ist es möglich noch feingliedriger zu unterteilen, jedoch zum Zwecke der Orientierung für Sie konzentriere ich mich auf das Wesentliche.
Wenn Sie die Ambitionen haben, sich in der Fördermittelberatung selbständig zu machen, ist dieser Beitrag für Sie als Leitfaden gedacht.
Für Ihren Erfolg in der Selbständigkeit als Fördermittelberater spielt es keine Rolle, ob Sie Quereinsteiger sind, wenig bis keine Vorkenntnisse in Bezug auf Fördermittel haben, das zunächst nebenberuflich betreiben möchten oder kein Geld für Kurse oder Seminare haben, die zwischen 3.000 und 10.000 EUR von Ihnen verlangen.
Natürlich geht es mit entsprechenden Vorkenntnissen, viel Startkapital oder professioneller Betreuung durch einen Mentor oder Coach schneller, aber all das ist nicht zwangsweise notwendig, damit Sie sich Ihre Selbständigkeit oder das Beratungsfeld in der Fördermittelberatung aufbauen. Ohne Startkapital und Mentor dauert es sicherlich länger und der Weg ist etwas holpriger, aber es ist möglich, wie in meinem Fall. Dieser Leitfaden bietet Ihnen einen kostenlosen, umfangreichen Einstieg mit hilfreichen Erkenntnissen und Ressourcen aus meiner Tätigkeit als Fördermittelberater.
Für all diejenigen, die gern schneller zum Ziel kommen möchten und bereit sind, die finanzielle Investition zu tätigen, bietet foerdershop.de ein 10-wöchiges, praxisorientiertes 1:1 Coaching als Weiterbildung zum Fördermittelberater mit Abschluss-Zertifikat an. Dazu finden Sie mehr Infos in Kapitel 9 am Ende des Beitrags.
Um als Fördermittelberater Mehrwerte zu liefern, müssen Sie sich folgende konkrete Fragen stellen:
- Können Sie als angehender Förderberater ein passendes Förderprogramm (oder mehrere) für den Kunden identifizieren?
- Wenn ja, wie viel Zuschuss oder Förderung können Sie als Fördermittelberater für den Kunden erwirken?
- Passt das Vorhaben des Kunden zum Förderprogramm?
- Welche Hürden gibt es auf dem Weg zur Bewilligung und Auszahlung zu überwinden?
- Kann der Kunde sich auf Ihr Wort verlassen?
Die Aneignung der theoretischen Grundlagen muss nicht über viele Monate oder gar mehrere Jahre ausgedehnt werden. Und schon gar nicht sollte man sich ausschließlich auf die Theorie beschränken, wie viele am Markt erhältliche Fördermittel-Seminare oder Weiterbildungen zu Fördermitteln dies tun. Um in der Fördermittelberatung erfolgreich zu werden, ist ein Mix aus Soft-Skills (Zeitmanagement, Zuverlässigkeit, Kommunikationsfähigkeit etc.) und fachspezifischen Fähigkeiten notwendig. Die Soft-Skills sind wichtig, werden in diesem Beitrag jedoch nur am Rande erwähnt. Wir fokussieren uns auf die fachspezifischen Fähigkeiten.
Sie möchten in der Selbständigkeit Geld verdienen und Kunden erfolgreich beraten, daher sollte die theoretische Ausbildung auf das Notwendigste reduziert werden, und so zeitnah wie möglich mit der Vermittlung des praktischen Wissens begonnen werden, damit Sie startklar für die kompetente Betreuung von Kunden in der Fördermittelberatung sind und sich dieser Weg für Sie lohnt.
Als ich damals vor der Entscheidung stand, einen solchen Fördermittel-Kurs zu buchen, habe ich mich dagegen entschieden und bin einfach ins kalte Wasser gesprungen und habe mir im Selbststudium das Wissen zu Fördermitteln angeeignet und mich viel mit Mitarbeitern von Förderstellen ausgetauscht und in meiner damaligen Tätigkeit bei einer Steuerberatungsgesellschaft gleichzeitig dieses Wissen erfolgreich für die Steuerberatungsgesellschaft und Mandanten angewendet. Sicherlich wäre die Wissensaneignung deutlich schneller mit einem kompetenten Coach an meiner Seite gegangen, aber damals fand ich nicht das am Markt für mich passende, pragmatische und auf die Praxis fokussierte Programm. Daher empfehle ich an dieser Stelle nichts, was ich selbst nicht gemacht habe. Dies kommt Ihnen jetzt zu Gute, weil ich von meiner Erfahrung berichte.
2. Über den Autor und die Anfänge in der Fördermittelberatung
Als Autor dieses Beitrags bin ich seit mehreren Jahren erfolgreich in der Fördermittelberatung selbständig tätig, vorrangig für Unternehmenskunden aus dem gesamten Bundesgebiet. Thematisch habe ich mich auf die Fördermittelbereiche Digitalisierung, Innovation, Investition und Beratung fokussiert.
Ich betreue Kunden von der Identifikation des passenden Förderprogramms auf Bundesland-, Bundes- oder auch EU-Ebene.
Auch ich habe einmal angefangen und verstand von vielen gängigen Begriffen in der Fördermittelberatung nur Bahnhof und fühlte mich vom Fördermittel-Dschungel erschlagen.
Mein erster Kontakt mit Fördermitteln ist mehrere Jahre her. Damals habe ich während meiner Tätigkeit für eine Saarländische Steuerberatungsgesellschaft die Registrierung als Beratungsunternehmen beim BAFA übernommen, inklusive der Erstellung des Qualitätsmanagement-Nachweises.
Mir wurde klar, dass die Fördermittelandschaft aus deutlich mehr Förderprogramen besteht als nur vom BAFA verwaltet werden. Manchmal liest man 3.000, manchmal 5.000, manchmal noch mehr oder weniger – wie viele es am Ende des Tages sind spielt keine große Rolle.
Für den Einstieg in die Fördermittelberatung ist es sinnvoller, wenn Sie sich auf ein paar wenige Förderprogramme fokussieren. Versuchen Sie nicht direkt mehrere tausend Förderprogramme in Ihr Leistungsportfolio aufzunehmen oder vorab zu studieren, sondern sich maximal 5 bis 10 interessante Förderprogramme herauszupicken und gezielt Kunden hierfür zu suchen. Das Vorgehen, um Fördermittel-Richtlinien zu erschließen, ist in vielen Fällen sehr ähnlich. Daher ist es ratsamer, sich tiefergreifend mit einigen wenigen am Anfang zu beschäftigen, als mit vielen oberflächlich. So bleibt mehr Wissen hängen.
Anfangs können Sie 5 bis maximal 10 Förderprogramme überschauen und anwenden. Sie können die Richtlinie studieren, die Nebenbestimmungen, Antrags- und Dokumentationsunterlagen und damit auch den möglichen Kunden gegenüber im Erstgespräch schon Kompetenz ausstrahlen. Die jeweiligen Förderprogramme haben immer bestimmte Zielgruppen, und das sind dann natürlich auch Ihre Zielgruppen.
Sie können auch den generalistischen Ansatz wählen und Fördermittelchecks für jeden anbieten, der Interesse hat. Meistens aber verschwendet das viel Zeit und ist nicht zielführend, weil Sie noch keine Referenzerfahrungen mit Fördermitteln haben und dem Kunden im Erstgespräch wenig Anhaltspunkte liefern können, ob Potential besteht. Wenn Sie sich in die Fördermittellandschaft thematisch eingearbeitet und erste praktische Erfahrungen gesammelt haben, wissen Sie, an welcher Stelle Sie suchen müssen und können relativ zügig filtern, ob Potential besteht.
Außerdem ist es bei ersterem Ansatz wahrscheinlicher, dass Sie schneller erste Erfolge feiern können in der Fördermittelberatung und somit am Ball bleiben.
Ich habe damals beide Ansätze probiert, mich mit vielen Richtlinien gleichzeitig zu beschäftigen und anschließend mich auf nur wenige zu fokussieren. Der letztere Ansatz ist deutlich gewinnbringender und effizienter für den Anfang.
3. Welche Aufgaben hat ein Fördermittelberater?
Was macht ein Fördermittelberater?
Ein Fördermittelberater analysiert aus ca. 3000 verfügbaren Förderprogramme die besten 1 bis 5 für Kunden und stellt Anträge, fordert Mittelauszahlungen an und kümmert sich um die administrative Abwicklung mit dem Ziel, die höchstmögliche Fördersumme für Kunden zu erwirken.
Der Steckbrief eines Fördermittelberaters sollte immer elementare Dinge umfassen, wie z.B. das Grundverständnis der Fördermittellandschaft. Darüber hinaus gibt es dann je nach geschäftlicher Ausrichtung des Dienstleisters Abweichungen (z.B. durch die Fokussierung auf Fördermittel für Unternehmen, gemeinnützige Einrichtungen, energetische Fördermittel etc.). Ein rundes Bild des selbständigen Fördermittelberaters ergibt sich meines Erachtens durch die Erfüllung der u.g. Tätigkeiten bzw. Verantwortungen.
- Recherche nach passenden Förderprogrammen im Auftrag des Kunden anhand individueller Kundenparameter (z.B. Beginn und Dauer des Vorhabens, Gesamtkosten und Einzelkostenansätze, Ort des Vorhabens, Ziele des Vorhabens etc.)
- Beratung des Kunden zu möglichen öffentlichen Förderprogrammen für das Vorhaben
- ohne konkretes Kundenvorhaben kann nur eine allgemeine Beratung zu Förderprogrammen erfolgen
- übernimmt die Vorbereitung von Antragsunterlagen, darunter auch die Formulierung von Vorhabensbeschreibungen
- kennt sich mit Begriffen der Förderlandschaft aus, z.B. De-minimis, KMU-Schwellenwerte, AGVO, Kleinbeihilfen
- weist Kunden proaktiv auf die einzuhaltenden Auflagen im Förderprojekt hin – diese stehen in der Regel im Zuwendungsbescheid, der Richtlinie sowie den Nebenbestimmungen
- übernimmt die Vorbereitung von Dokumentationsunterlagen, darunter die Formulierung des Sachberichts, des zahlenmäßigen Nachweises
- kommuniziert mit der Förderstelle zur Bearbeitung von Rückfragen oder Nachbearbeitungen
- übernimmt die Einreichung von Unterlagen im Zusammenhang mit Antrag und Dokumentation bei der Förderstelle und beachtet ggf. anwendbare Fristen
- kann dem Kunden Vor- und Nachteile verschiedener Förderprogramme verständlich vermitteln, immer bezogen auf die individuelle Kundensituation
- hat ein konzeptionelles Verständnis von Förderinstrumenten (z.B. Zuschuss, Förderkredite, Bürgschaften, Mezzaninekapital), Förderthemen (z.B. Innovation / Digitalisierung / Investition) sowie Förderebenen (Land, Bund, EU).
- informiert sich regelmäßig über Änderungen in der Förderlandschaft (z.B. über das Internet, durch Gespräche mit Förderstellen, Netzwerke etc.)
4. Honorar und Honorargestaltung in der Fördermittelberatung
Die Vergütungsmodelle in der Fördermittelberatung sind entweder pauschalbasiert oder erfolgsabhängig.
Bei der pauschalen Vergütung vereinbart man mit dem Kunden in der Regel einen festen Stundensatz oder ein pauschales Honorar für die Dienstleistung. Der Stundensatz nimmt in der Regel eine Spannweite zwischen 80 und 150 EUR zzgl. USt. pro Stunde ein. Alternativ zu einem festen Stundensatz gibt es die Möglichkeit eine Pauschale für die Einreichung eines Antrags oder der Dokumentation zu vereinbaren.
Erfahrungsgemäß bevorzugen viele Kunden die erfolgsabhängige Vergütung, da bei dieser Variante nur eine Gebühr anfällt, wenn zumindest die Bewilligung oder die Auszahlung der Zuwendung eintritt. Die Konditionen sind natürlich individuell verhandelbar. In der Praxis hat sich bei uns bewährt, 50 % der vereinbarten erfolgsabhängigen Vergütung nach Erhalt des Zuwendungsbescheid zu verlangen. Die restlichen 50 % der Vergütung werden dann anteilig mit der Auszahlung des Zuschusses fällig.
Möglich ist auch die ausschließliche Auszahlung des Honorars anteilig mit der Auszahlung des Zuschusses. Der Nachteil bei dieser Variante für den Fördermittelberater besteht darin, dass dieser manchmal erst sehr spät das Geld sieht. Von Erstellung der Antragsunterlagen bis zur ersten Auszahlung können schon einmal 6 bis 12 Monate vergehen. Daher arbeiten wir grundsätzlich mit der Regel 50 % der erfolgsabhängigen Vergütung bei Bewilligungsbescheid.
Die Höhe der erfolgsabhängigen Vergütung beträgt in der Regel zwischen 5 und 15 % vom Zuschuss. Je nach Aufwand kann dies variieren. Nur weil ein Kunde A deutlich mehr Zuschuss einwirbt als ein Kunde B, heißt das nicht automatisch für die erfolgsabhängige Vergütung, dass diese für Kunde A vorteilhafter ausfällt. Somit kann z.B. deutlicher Mehraufwand für die Antragstellung und Projektmanagement dazu führen, dass dieser den gleichen oder einen höheren erfolgsabhängigen Prozentsatz angeboten bekommt, als Kunde B.
Sie können natürlich auch dem Kunden die Wahl lassen, ob dieser lieber eine pauschale oder die erfolgsabhängige Vergütung oder ggf. auch eine Kombination aus beiden Möglichkeiten wählt. Wohlwissend, dass die erfolgsabhängige Vergütung den Kunden im Erfolgsfall teurer zu stehen kommt als die pauschale, da Sie als Fördermittelberater das Risiko der Nichtbewilligung und damit eines wirtschaftlichen Ausfalls tragen.
5. Kann ich meine Leistungen als Fördermittelberater fördern lassen?
Die Fördermittelberatung als Beratungsleistung oder administrative Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Anfertigung von Förderprogrammen wird in der Regel nicht bezuschusst. Bei der BAFA-Beratungsförderung (Förderung von Unternehmensberatungen für KMU) ist die Fördermittelberatung explizit von der Förderung ausgeschlossen. Bekannterweise fördert die BAFA-Beratungsförderung konzeptionelle Beratungen. Sprich Sie als Berater decken Schwachstellen sowie deren Ursachen beim Kunden auf und geben Handlungsempfehlungen, wie diese verbessert werden können.
Die Fördermittelberatung verstehe ich und viele meiner Berufskollegen als Teil der Unternehmensberatung. Somit können Sie die konzeptionelle Unternehmensberatung beim Kunden, die nicht direkt die Übernahme administrativer Tätigkeiten im Zusammenhang mit Förderprogrammen oder allgemein Förderberatung betrifft, auch beim BAFA für den Kunden zur Förderung Ihres Beraterhonorars einreichen.
Damit Ihre Beratungsleistung gefördert werden kann über das Förderprogramm Förderung von Unternehmensberatungen für KMU, müssen Sie beim BAFA als Berater registriert sein. Unser Produkt BAFA Berater Registrierung bietet Ihnen hierfür das passende Werkzeug.
Zusätzlich zur bundesweiten Beratungsförderung vom BAFA, können Sie bzw. Ihre Kunden bundeslandspezifische Förderprogramme zur Beratung in Anspruch nehmen. Die Förderquote bewegt sich meist um die 50 % und es können in der Regel mehrere tausend Euro Zuschuss generiert. Teilweise ist bei den Beratungsförderprogrammen eine Registrierung des Beraters notwendig, manchmal reicht das Vorzeigen der Listung als BAFA-Berater aus, und in anderen Fällen ist überhaupt keine Autorisierung notwendig. Die Kriterien unterscheiden sich von Bundesland zu Bundesland. Die Auflistung der Beratungsförderprogramme wird Teil eines zukünftigen Blogbeitrags. Die besten Anlaufpunkte, damit Sie jetzt ein passendes Beratungsförderungsprogramm finden, werden Ihnen im Kapitel 8 vorgestellt.
6. Wie lege ich konkret los?
Wie oben beschrieben, müssen wir zunächst die wichtigsten theoretischen Grundlagen legen, bevor eine Beratung am Kunden erfolgen kann. Sinnvollerweise sollten Sie sich zunächst mit den rechtlichen Grundbegriffen der Fördermittellandschaft beschäftigen, wie z.B. De-minimis und der De-minimis-Verordnung sowie der Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung. Fördermittel werden in der Regel nach einem der beiden rechtlichen Rahmen vergeben. Das wichtigste Unterscheidungskriterium sind die Kumulierungsschwellenwerte. Bei den De-minimis-Beihilfen werden maximal 300.000 EUR Zuschuss innerhalb von 3 rollierenden Kalenderjahren vergeben. Fördermittel, die nach der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung vergeben werden, können deutlich umfangreicher sein und in die Millionen gehen.
Außerdem beschäftigen Sie sich mit den Schwellenwerten in Bezug auf Umsatz, Mitarbeiteranzahl und Bilanzsumme für kleine und mittlere Unternehmen der EU. Begriffe, die Ihnen nicht geläufig sind, werden Sie im Tagesgeschäft nachschlagen oder die Förderstelle um eine kurze Erklärung bitten.
Beide Rechtsrahmen sowie die EU-KMU-Schwellenwerte sind in separaten Blogbeiträgen auf foerdershop.de erklärt.
Zudem bietet es sich an, dass Sie sich direkt mit den gängigen Tools & Ressourcen im Kapitel 8 vertraut machen. Das kann z.B. beinhalten, welche besonders interessanten Förderprogramme Ihr Bundesland aktuell für eine bestimmte Zielgruppe, wie z.B. Unternehmen, auf der Seite der jeweiligen Investitionsbank anbietet. Oder Sie interessiert das Thema Digitalisierung, dann nehmen Sie sich gern die verschiedenen Internetseiten der Investitionsbanken der Bundesländer und vergleichen ggf. auf eigene Initiative die Förderprogramme. Auch hier bietet foerdershop.de einen Beitrag zu den verfügbaren Fördermitteln zu Digitalisierung.
Ihre Ergebnisse können Sie auch gern in den sozialen Medien posten. Insbesondere bei Xing gibt es Gruppen zu Fördermitteln, Gruppen für Unternehmer und betriebswirtschaftlich Interessierte und mehr. Auch ich habe vor ein paar Jahren Beiträge zu Fördermitteln in den sozialen Medien veröffentlicht und sehr gute Kundenkontakte darüber erhalten.
Am Anfang geht es nicht darum die komplette Fördermittellandschaft zu studieren, sondern wenige Förderprogramme zu finden, die einen Mehrwert bieten, und diese kennenzulernen. Zum Kennenlernen der Programme sollten Sie die öffentliche Seite des Projektträgers zum jeweiligen Förderprogramm, diese kann z.B. von einer Investitionsbank eines Landes oder einem privaten Projektträger betrieben werden, studieren. Es finden sich auf solchen Seiten immer hilfreiche Zusammenfassungen des Förderprogramms und die Rechtsgrundlage sowie Dokumente zum Antrag und Dokumentation.
Schauen Sie sich auch die Zusammenfassungen zum Förderprogramm sowie die Richtlinie an. Der gesamte Prozess bei der Förderstelle basiert inhaltlich auf der Richtlinie. Wenn Sie Passagen nicht verstehen, weil z.B. ein Begriff zu schwammig in der Richtlinie formuliert wurde (kann häufiger vorkommen) – melden Sie sich telefonisch oder per E-Mail bei der Förderstelle und bitten Sie um kurze Erklärung. Die Förderstellen sind für öffentliche Anfragen verfügbar. Daher keine Scheu. Wenn Sie anschließend die Ziele und Zielgruppe der Förderrichtlinie, die Konditionen der Förderung und den Prozess der Antragstellung verstanden haben, sind Sie schon bereit, um Kunden diesbezüglich zu betreuen!
Anfangs habe ich den Fehler gemacht, zu viele Richtlinien auf einmal studieren zu wollen. Kein Fördermittelberater kennt alle Richtlinien, genauso wenig wie ein Steuerberater alle Steuergesetze kennt. Sie müssen das Grundlagenwissen haben, was mit der Zeit um entsprechende Erfahrung in der Fördermittelberatung erweitert wird, und anschließend wissen, an welchen Stellen Sie nachschauen oder nachfragen müssen, damit Sie den Fördermittelantrag abwickeln können.
7. Methodik zur Recherche & Bearbeitung von Förderanträgen
Die Recherche von Förderprogrammen beginnt für mich klassischerweise auf den Seiten der Investitionsbanken, bzw. der Förderdatenbank oder den Seiten der Projektträger. Denkbar ist es auch Keywords wie z.B. Förderung Digitalisierung Brandenburg, Förderung Existenzgründung Hessen oder Ähnliches bei Google einzugeben. Die Projektträger und Investitionsbanken werden in der Regel in den relevanten Suchergebnissen auftauchen. In der Förderdatenbank haben Sie viele relevante Richtlinien vereint. Dies ist jedoch nur die erste Anlaufstelle, weil die Förderdatenbank selbst keine Förderprogramme administriert oder Gelder vergibt. Die Ansprechpartner werden auch dort genannt auf den jeweiligen Ergebnisseiten genannt. Diese können Sie dann bei Fachfragen kontaktieren.
Zur Recherche passender Förderprogramme, insbesondere wenn es Investitionsbanken betrifft, haben Sie auch eine Hotline. Wenn Sie dort anrufen, können Sie sich informieren, ob es passendes Förderprogramm zu Ihrem Vorhaben gibt. Die Hotline vermittelt Sie in der Regel in die relevante Abteilung, z.B. Wirtschaftsförderung oder Weiterbildungsförderung. Und dort stellen Sie dann kurz das Unternehmen und Vorhaben vor. Die Sachbearbeiter in der Abteilung können relativ schnell beurteilen, ob Ihr vorgestelltes Vorhaben Förderpotential hat oder nicht.
Idealerweise sollten Sie im Zuge der Förderrecherche nicht nur ein bestimmtes Unternehmen im Kopf haben, sondern auch ein konkretes Vorhaben. Fördermittelrecherchen allein auf Basis von Parametern zum Unternehmen, ohne Infos zum konkreten Vorhaben, durchzuführen, ist in der Regel nervenaufreibend und wenig zielführend. Daher empfehle ich Ihnen, lassen Sie sich relevante Informationen zum Projekt wie z.B. Beginn und geplantes Ende des Vorhabens, Gesamtkosten und Einzelkostenansätze, eine kurze, jedoch aufschlussreiche Vorhabensbeschreibung geben. Wenn einige Parameter diesbezüglich noch nicht klar, können diese auch als flexible Parameter in die Recherche einbezogen werden. Dann können Sie beispielsweise die geplante Projektlaufzeit an der maximal möglichen vorgegebenen Projektdauer der Richtlinie orientieren.
Sobald Sie eine mögliches Fördermittelprogramm identifiziert haben, werfen Sie bitte einen Blick auf die Zusammenfassungen zu Förderquote, Förderhöhe, antragsberechtigten Unternehmen, Förderthemen und sonstige Förderausschlüsse. Wenn das grob passt, können Sie sich nun die Richtlinie vorführen. Richtlinien sind der Regel sehr ähnlich strukturiert. Wenn Sie mehrere voneinander unabhängige Richtlinien vergleichen, stellen Sie fest, dass z.B. die Geltungsdauer bzw. Befristung der Richtlinie nahezu immer der letzte Punkt ist, oder dass die Ziele der Richtlinie in der Regel sehr nah am Anfang zu finden.
Die Richtlinie zu kennen stellt die Basis für Ihre Argumentation dar, warum das Projekt Ihres Kunden durch das identifizierte Förderprogramm begünstigt werden sollte. Denn das Projekt Ihres Kunden sollte immer den Zielen der Förderrichtlinie zuträglich sein, es sollten keine harten Bedingungen der Richtlinie gerissen sein und auch das Vorgespräch von Ihnen mit einem Sachbearbeiter zum Projekt des Kunden sollte positiv ausfallen oder zumindest keine offensichtlichen Dealbreaker offenlegen.
Viele angehende Fördermittelberater tun sich schwer mit den Formulierungen der Vorhabensbeschreibung für einen Förderantrag. Das ist in der Regel auch der schwierigste Part für viele, weil es darum geht einen zusammenhängen Text zu schreiben und das Vorhaben für die Förderung zu bewerben. Das Vorausfüllen der anderen Antragsdokumente, in denen überwiegend Stammdaten oder einfache Informationen wie z.B. Umsatz, Bilanzsumme oder Mitarbeiteranzahl abgefragt werden, sollte keine Herausforderung darstellen.
An dieser Stelle macht es sich bezahlt, wenn Sie die Richtlinie kennen. Nun können darstellen, wie das Vorhaben Ihres Kunden zur Erfüllung der Ziele der Richtlinie beiträgt. Was sich immer durch eine Vorhabensbeschreibung ziehen wird, ist zudem, dass Sie die sparsame und wirtschaftliche Verwendung von Fördermitteln darstellen. Beispielsweise sollten Sie nicht 500 EUR pro Stunde für einen Webprogrammierer ansetzen, auch wenn die Richtlinie formal keine Begrenzungen hinsichtlich des Stundensatzes vorgeben mag. Es besteht kein Anspruch auf Zuschüsse, auch wenn Sie alle Bedingungen formell erfüllen. Vielmehr entscheidet jede Bewilligungsbehörde im Rahmen des Kontingents, welche Projekte bewilligt werden. Nicht immer gilt daher das Windhundprinzip.
Meistens gibt es für die Vorhabensbeschreibung dennoch Vorgaben seitens der Förderstelle, welche Struktur oder Punkte abgedeckt werden müssen. Diese sollte Sie idealerweise in der Reihenfolge, die vorgegeben ist, berücksichtigen. Je leichter Sie es dem Sachbearbeiter machen, die Bearbeitung Ihres Förderantrags zeiteffizient durchzuführen, umso größer Ihre Chance Pluspunkte zu sammeln. Auch Sachbearbeiter sind menschliche Wesen, mit allem was dazu gehört.
Da eine Richtlinie oftmals Ermessensspielräume bietet für Sachbearbeiter bei der Bewertung Ihres Vorhabens, kann es passieren, dass bei 3 Sachbearbeitern 3 unterschiedliche Meinungen zu einem Vorhaben entstehen. Die Förderstellen versuchen sich intern abzusprechen und kohärent nach Außen aufzutreten, aber das gelingt natürlich nicht immer. Wenn Sie zumindest einen guten, professionellen und durchdachten Eindruck hinterlassen in Bezug auf Ihre Arbeit, machen Sie es dem Sachbearbeiter leichter, im Rahmen seiner Möglichkeiten zu Ihren Gunsten zu entscheiden.
Nutzen Sie für eine Antragseinreichung auch immer eine Checkliste für die Antragsdokumente, um sicherzustellen, dass Sie vollständig den Antrag bei der Förderstelle einreichen. Nachbearbeitungen oder Nachforderungen sollten von Ihnen so gut wie möglich vermieden werden im Sinne einer effizienten und zeitnahen Bearbeitung des Förderantrags. Einige Förderstellen benötigen die Antragsdokumente noch postalisch im Original, andere hingegen arbeiten komplett digital, und widerrum einige arbeiten selbst innerhalb eines Förderprogramms mit beiden Ansätzen. Dort können Sie einige Dokumente digital einreichen, andere müssen noch postalisch versendet werden. Idealerweise klären Sie das vor der Einreichung der Unterlagen.
Nach vollständiger Einreichung des Förderantrags heißt es abwarten, bis die Förderstelle auf Sie bzw. Ihren Kunden zukommt. Einzelne Nachbearbeitungen oder Nachforderungen sind durchaus üblich, besonders bei komplexeren Projekten. Damit Sie diese für den Kunden lösen können, empfiehlt sich die Einreichung einer Vollmacht bei der Förderstelle, ausgestellt durch Ihren Kunden.
Untenstehend eine Vorlage, die von meinem Rechtsanwalt angefertigt wurde für Sie kostenlos zum Download.
Vollmacht Wordvorlage 1 Datei
8. weitere Ressourcen & Tools
Die Tools & Ressourcen wurden oben schon angeschnitten. Zusammenfassend sind das zur Recherche von Förderprogrammen:
Datenbank vielfältiger Förderprogramme:
Die einzelnen Investitionsbanken der Bundesländer bzw. Landesförderinstitute
9. Schneller zum Ziel kommen mit foerdershop.de
Die professionelle Betreuung durch ein individuelles Coaching bringt Sie deutlicher schneller zum Ziel, als sich die Fähigkeiten und Kenntnisse zur Fördermittelberatung mühsam in Eigenregie und mit Versuch und Irrtum anzueignen.
foerdershop.de bietet 3 Optionen mit unterschiedlichem Betreuungsumfang an:
- Erstberatung von maximal 1 Stunde mit Vor-und Nachbereitung zu wichtigen Themen / konkreten Fragen für 229 EUR.
- Auswahl von 2 Modulen siehe unten für 1.990 EUR.
- 10-wöchiges 1:1-Coaching mit 2 Std. live-Sessions pro Woche per Videokonferenz für 5.490 EUR mit folgenden Modulen ab dem 01.07.2025:
10-wöchiges 1:1 Coaching zum Fördermittelberater
Zum Ende einer Lektion können Hausaufgaben vergeben werden. Diese hängen vom individuellen Wissensstand und der zeitlichen Verfügbarkeit des Teilnehmers ab. Ein Beispiel für Hausaufgaben ist die selbständige Formulierung einer Vorhabensbeschreibung auf Basis einer vorgegebenen Ausgangssituation des Kunden. Die Kontrolle erfolgt dann am Anfang der nächsten Lektion gemeinsam.
Lektion 1: Übersicht & Einführung Fördermittellandschaft
1. Ihre Vorerfahrungen mit Fördermitteln & Ihre Erwartungshaltung an das Coaching
1.1 Hintergrundinformationen zur Person
1.2 Berührungspunkte & Erfahrungen mit Fördermitteln
1.3 mögliche Laufbahn in der Fördermittelberatung
1.4 Erwartungshaltung an das Coaching
2. Berufsbild & Aufgaben Fördermittelberater
3. Übersicht Fördermittellandschaft
3.1 Förderinstrumente
3.2 Zuschüsse
3.3 Förderkredite
3.4 Öffentliche Bürgschaften
3.5 Öffentliches Mezzaninekapital
3.6 Garantien
4. Förderebenen
4.1 EU-Fördermittel
4.2 Fördermittel auf Bundesebene
4.3 Fördermittel der Bundesländer
5. Übergreifende Förderthemen in Deutschland und EU
5.1 Digitalisierung
5.2 Innovation
5.3 Investitionen
5.4 Unternehmensberatung
5.5 Gründung und Nachfolge
5.6 Energie
6. Förderperioden und Evaluierungen
6.1 vorherige Förderperiode 2014 – 2020
6.2 aktuelle Förderperiode 2021 – 2027
7. Förderstellen und Projektträger
7.1 Förderstellen auf Bundeslandebene
7.2 Förderstellen auf Bundesebene
8. Grundsätzlicher Antragsprozess (Praxisbeispiel 1)
8.1 Bedarfserfassung / Fördermittelcheck
8.2 Richtlinie 1 analysieren
8.3 Prüfung der Voraussetzungen der Richtlinie in Bezug auf das Kundenvorhaben
Lektion 2: Rechtsrahmen Fördermittel AGVO/De-minimis/Kleinbeihilfen, Höchstgrenzen und Kombinierbarkeit von Fördermitteln nach Rechtsrahmen
8.4 Antragsverfahren (Fortsetzung Praxisbeispiel 1)
8.4.1 De-minimis-Erklärung
8.4.2 KMU-Erklärung
8.4.3 Vorhabensbeschreibung
8.4.4 Erklärung Unternehmen in Schwierigkeiten
8.4.5 aktueller Unternehmensnachweis und Datenbanken
8.4.6 online-Antragsstrecke vs. Papierantrag
8.4.7 Auftragsvermerk
8.4.8 Erhebungsbogen
8.4.9 Erklärung zur Datenverarbeitung
8.4.10. Erklärung zur Auftragsvergabe
8.4.11 Unterschriftskarte
8.4.12 Vollmacht
8.4.13 Vollständigkeitsprüfung
8.4.14 Bewertungsfristen
8.4.15 anonymisierter Zuwendungsbescheid 1 – 70.000 EUR Zuschuss
8.4.16. Rechtsbehelfsverzicht
9. Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union
9.1 Artikel 107
9.2 Artikel 108
9.3 Artikel 109
10. EU-KMU Begriff Definition
10.1 Kleinstunternehmen
10.2 kleine Unternehmen
10.3 mittlere Unternehmen
10.4 Beteiligungsverhältnisse und Einfluss auf Bewertungen
11. De-minimis-Regelung
11.1 De-minimis-Verordnung Version 2023
11.2 De-minimis-Schwellenwerte und Berechnungen
11.3 Subventionswert vs. Bruttosubventionsäquivalent
12. Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO)
12.1 AGVO-Verordnung Version 2023
12.2 AGVO-Schwellenwerte
13. Subventionsbericht Deutschland
Lektion 3: Fördermittelrecherchetools & Arbeitsmethodiken zur Antragstellung und Dokumentation, Aufbau & Inhalt von Richtlinien
14. Förderdatenbank
15. Investitionsbanken der Länder
16. Bürgschaftsbanken
17. Mittelständische Beteiligungsgesellschaften
18. Projektträger
19. BAFA
20. Richtlinien analysieren (Praxisbeispiel 2, Praxisbeispiel 3)
20.1 Förderziele
20.2 Gegenstand der Förderung
20.3 Zuwendungsempfänger
20.4 Zuwendungsvoraussetzungen
20.5 interne Verwaltungspraxis vs. Zuwendungsvoraussetzungen
20.6 Art, Umfang, Höhe der Förderung
20.7 Prozess / Verfahren
20.8 Geltungsdauer
21. Dokumentationsverfahren (Fortsetzung Praxisbeispiel 1)
21.1 De-minimis-Bescheinigung
21.2 Vermerk über die Erteilung eines Auftrags
21.3 Verwendungsnachweis
21.4 Zahlungstool als Exceldatei
21.5 Sachbericht
21.6 eCohesion-Portal
21.7 Nachbearbeitungen
22. Wettbewerbsrunde vor Antragstellung (Praxisbeispiel)
22.1 Unterlagen
22.2 Projektskizze
22.3 Screenshots Antragstellung
23. Antragstellung Praxisbeispiel BIG-Digital
Lektion 4: Digitalisierungsförderung Deutschland und nach Bundesland
24. Übersicht zur Digitalisierungsförderung in Deutschland
25. Analyse einzelner Förderprogramme zur Digitalisierung
26. Antragstellung Digitalisierungsförderung (Fortsetzung Praxisbeispiel 2)
26.1 Antrag
26.2 eingeholte Angebote
26.3 Ausgabenplanung
26.4 Ist-Soll-Zustand Digitalisierung der Prozesse
26.5 Vorhabensbeschreibung
26.6 Zuwendungsbescheid ca. 80.000 EUR Zuschuss
27. Antragstellung & Dokumentation Digitalisierungsförderung (Praxisbeispiel 4)
27.1 Richtlinie
27.2 Ausgangssituation des Kunden
27.3 Angebot
27.4 Zuwendungsbescheid 50.000 EUR Zuschuss
27.5 Verwendungsnachweis
28. Formulierungen in Angeboten Digitalisierungsförderung (Praxisbeispiel 5)
28.1 Ausgangsangebot Dienstleistungen
28.2 Ausgangsangebot Lizenzen
28.3 Finales Angebot
28.4 Zuwendungsbescheid ca. 15.000 EUR
Lektion 5: Investitionsförderung Deutschland und nach Bundesland
29. GRW-Koordinierungsrahmen ab 2024 im Detail
30. Fördergebietskarte
31. GRW-Förderung Berlin (Praxisbeispiel)
31.1 Richtlinie
31.2 Antragsformular
31.3 Unternehmensdarstellung
31.4 Finanzunterlagen
31.5 KMU-Erklärung
31.6 Investitionsgüterliste
31.7 Vorhabensbeschreibung
31.8 Politisch exponierte Person
31.9 Umweltauswirkungen
32. weitere Beispiele Investitions- und GRW-Förderung
32.1 GRW-Förderung Brandenburg
32.2 Investitionszuschussprogramm Rheinland-Pfalz
32.3 RWP-Beratung Nordrhein-Westfalen
Lektion 6: Innovationsförderung in Deutschland
33. Übersicht Innovationsförderung in Deutschland
34. Begriffe und Grundlagen der Innovationsförderung
34.1 Grundlagenforschung
34.2 Industrielle Forschung
34.3 Experimentelle Entwicklung
34.4 Technologische Innovation
34.5 Abgrenzung zur Förderung der Digitalisierung und Investition
34.6 AGVO und De-minimis im Kontext der Innovationsförderung
35. ZIM-Förderung
35.1 ZIM-Richtlinie
35.2 Projektskizze
35.3 Durchführbarkeitsstudie
35.4 FuE-Einzelprojekt Antragstellung
36. FuE Mecklenburg Vorpommern
36.1 Richtlinie Forschung und Entwicklungsvorhaben
36.2 Projektskizze
36.3 Antrag und Anlagen
36.4 Projektbeschreibung Gliederung
36.5 Vergleich mit ZIM
37. Innovationsförderung Brandenburg
37.1 Innovationsassistent Brandenburg
37.2 Gründung innovativ 2022 Brandenburg
38. Innovationsförderung NRW
38.1 MID-Analyse
38.2 MID-Innovation
Lektion 7: EU-Fördermittel
39. EU-Fördermittel Überblick
39.1 Statistiken zu Bewilligungen und Budgets
39.2 EU-Förderprogramme
40. Einführung in das Funding & Tenders Portal der EU
40.1 Übersicht Portal
40.2 Funding
40.3 Tenders
40.4 Registrierung
40.5 Antragsmaske
40.6 Online-Manual
41. Förderaufruf AI Continent
42. Model Grant Agreement
43. Erfolgsbeispiele
Lektion 8: weitere Antragstellung verschiedener Förderprogramme, Zuwendungsbescheide und Nebenbestimmungen, BAFA-Registrierung
44. Sachsen EFRE Digitalisierung
44.1 Richtlinie
44.2 SAB-Website EFRE Digitalisierung Überblick
44.3 Antragsmaske
44.4 anonymisierte Antragsdokumente
44.5 anonymisierter Zuwendungsbescheid ca. 30.000 EUR
44.6 Verwendungsnachweis
45. Auflagen Zuwendungsbescheid
45.1 Projektbezogene Auflagen
45.2 Allgemeine Auflagen
45.3 Informations- und Kommunikationspflichten
46. Allgemeine Nebenbestimmungen
47. BAFA-Berater-Registrierung
47.1 Anforderungen
47.2 Lebenslauf
47.3 QM-Vorlage individualisieren
47.4 BAFA Account anlegen
47.5 Unterlagen einreichen
48. BAFA Dokumentation
48.1 Prozess & Unterlagen
48.2 BAFA-Berichte
Lektion 9: Umgang mit Nachbearbeitungen / Nachforderungen / Vermeidung von Rückforderungen von Zuschüssen, Rückforderungsbescheide, Subventionsbetrug, Verwaltungskostenbescheide
49.Nachbearbeitungen 5 Praxisbeispiele
50. Subventionsbetrug nach §264 StGB
51. Rückforderungsbescheide und -anlässe
52. Zinsbescheide und Zinsberechnungen
53. Verwaltungskostenbescheide
54. Best-Practices in der Fördermittelberatung
Lektion 10: Vergütungsmodelle Fördermittelberatung, Kundenakquise & Marketing, Zusammenfassung der Lektionen & Wiederholung relevanter Inhalte nach Bedarf, AGB, Beratungsvertrag, Vollmacht, Abschlussgespräch, Teilnahmezertifikat
55. Vergütungsmodelle
55.1 pauschale Vergütung
55.2 erfolgsabhängige Vergütung
55.3 hybride Vergütungsmodelle
56. Vertragsgrundlagen
56.1 AGB
56.2 Beratungsvertrag
56.3 NDA
56.4 Vollmacht
57. Marketing in der Fördermittelberatung
57.1 Online-Marketing
57.2 Erfahrungen aus eigener Webentwicklung
58. Wiederholung und Zusammenfassung vorheriger Lektionen
59. Fachliche Schwächen / Stärken aus Teilnehmersicht
60. Teilnehmerzertifikat und Feedback
Das beste Preis-/Leistungsverhältnis bietet das 10-wöchige 1:1-Coaching. In der Regel reichen 1-2 Kunden in der Fördermittelberatung damit sich die Investition in das 10-wöchige Coaching gelohnt hat. Die Inhalte der Betreuung sind auf Unternehmenskunden zugeschnitten.
In allen Modulen ist die Gebühr gegen Vorkasse zu entrichten. Die o.g. Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer.
10-wöchiges Coaching Curriculum als PDF 1 Datei
Autorenprofil & Haftungsausschluss
Dieser Beitrag wurde von Alexander Thiem, Fördermittelberater und Geschäftsführer der DigitalCore Products & Consulting Limited, geschrieben.
Die vorstehende Information ersetzt keine professionelle Beratung oder Betreuung und stellt keine Rechts- oder Steuerberatung dar. Es kann insbesondere eine Anpassung für den Einzelfall oder aufgrund anderer Umstände, z.B. wegen inzwischen geänderter Rahmenbedingungen notwendig sein. Eine Verwendung der Informationen geschieht auf eigene Verantwortung des Nutzers. Gerne stehen wir Ihnen für eine professionelle Beratung bei Bedarf zur Seite.